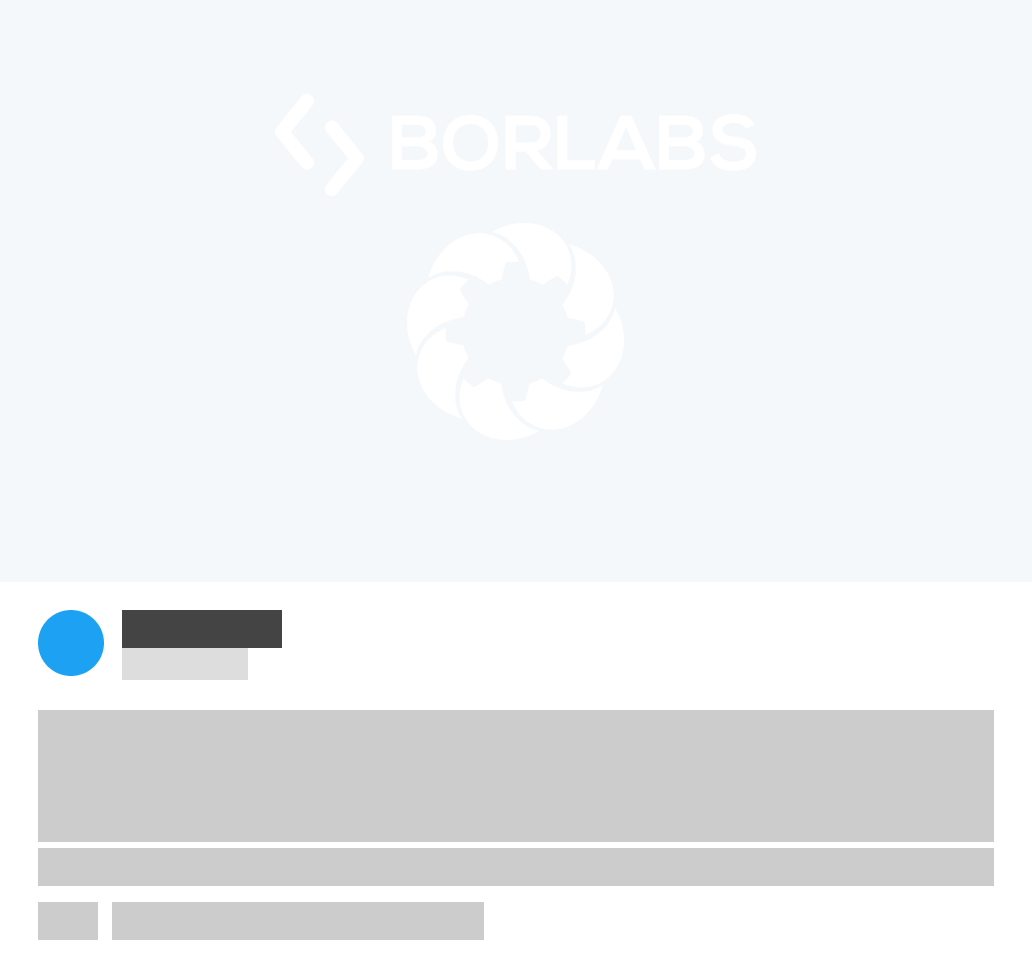Laufschuhe an, Kopfhörer auf – für viele Sportlerinnen und Sportler gehört Musik zum Training dazu. Beethovens Mondscheinsonate steht dabei eher selten auf der Playlist. Wer laufen geht, mag meist den schnellen Beat. Warum eigentlich? Pusht er uns tatsächlich zu Höchstleistungen?
Wenn die Akkus seiner Kopfhörer leer sind, ist für Jochen Steffens, Professor für musikalische Akustik, definitiv kein Lauftag. Wie bei vielen anderen Läuferinnen und Läufern braucht er Musik auf die Ohren, wenn er trainiert. Ohne geht’s nicht – oder eben nur sehr schwer, sagt der Wissenschaftler der Hochschule Düsseldorf. Wer läuft, kennt den Effekt: Mit Musik sind wir schneller unterwegs. Und irgendwie ist es weniger anstrengend. Musik steigert also unsere Leistung? „In erster Linie steigert sie unsere Stimmung“, sagt Jochen Steffens. „Bestimmte Musik macht uns fröhlicher. Sie hilft uns, negative Emotionen auszublenden. Dadurch können wir körperliche Anstrengungen und Erschöpfungszustände ein Stück weit ausblenden und sogar Schmerzen mildern.“
Musik als sportlicher Vorteil
Das klingt fast so, als hätte Musik eine magische Wirkung auf uns. Und tatsächlich: Untersuchungen legen nahe, dass sie Athletinnen und Athleten einen Vorteil verschaffen kann, berichtet Tom Fritz, Professor für empirische Musikforschung am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. „Musik, die uns Spaß macht, kann besonders wirksam dabei sein, dass wir Übungen oder ein regelmäßiges Training durchhalten.“
Ein Schlüssel für diese Wirkung sei die Synchronisation. Läuferinnen und Läufer könnten ihre eigenen Bewegungen an den Rhythmus der Musik anpassen. Das Prinzip ist nicht neu: Archäologische Befunde zeigen, dass schon unsere steinzeitlichen Vorfahren die Synchronisation zu Musik genutzt haben, um ihre Gruppenzusammengehörigkeit und letztlich sich selbst zu stärken – beispielweise bei Riten und Tänzen. Und auch in der früheren Geschichte lassen sich unzählige Beispiele finden, bei denen Musik mit Arbeit und Leistung verknüpft wurde: Arbeiter im Steinbruch oder beim Baumfällen im Wald nutzten gemeinsame Lieder ebenfalls, um ihrer Tätigkeit einen Rhythmus zu verleihen. Und danach funktioniert im Prinzip auch jedes Wanderlied.
Der schnelle Beat tut nicht allen gut
Wir müssen also nur eine Playlist mit den perfekten Lauf-Beats zusammenstellen, könnte man meinen. Da wäre zum Beispiel „Paint it black“ von den Rolling Stones. Dieser Song hat circa 159 bpm – also 159 Beats pro Minute. Passt dieses schnelle Tempo zum eigenen Laufrhythmus, ist das Match quasi perfekt: Läuferinnen und Läufer laufen im Einklang mit der Musik. Dann hören wir jetzt einfach alle die Rolling Stones während des Trainings? Keine gute Idee, sagt Jochen Steffens. „Jeder Mensch hat sein eigenes Lauftempo. Schnelle Beats tun dem einen vielleicht gut, können beim anderen aber schnell zu Überlastungen führen.“ Die Gefahr sei groß, mit zu schneller Musik eben auch zu schnell zu laufen. Damit sei nichts gewonnen.
Musik kann dem Flow auch schaden
Den perfekten, universellen „Beat pro Minute“ gibt es also nicht. Wichtiger ist es, Musik zu finden, die zum eigenen Lauftempo passt, sagt Jochen Steffens. Hinzu käme, dass Menschen, die zu Musik laufen, über ein gewisses Maß an Musikalität verfügen müssten. „Wem es schwerfällt, im Takt zu bleiben, wird wenig vom Beat haben. Dann wirkt die Musik eher irritierend und bringt uns raus aus dem Flow.“ Auch würden keine Läuferin und kein Läufer permanent dasselbe Tempo halten. „Wenn wir nicht gerade auf einem Laufband trainieren, können uns beispielsweise Steigungen ausbremsen. Auch andere Personen, die wir überholen möchten oder von denen wir überholt werden, beeinflussen das Tempo, genauso wieder jeder Stein, der uns in die Quere kommt.“ All das sorge dafür, dass wir nicht immer zum Beat der Musik laufen könnten.
Tipp: Eigene Playlist zusammenstellen und aufs Bauchgefühl hören
Um die leistungssteigernden Eigenschaften von Musik sinnvoll nutzen zu können, rät Professor Jochen Steffens, sich seine Playlists selbst zusammenzustellen und nicht nur auf Vorschläge anderer zu bauen. „Die eigene Lieblingsmusik hat immer die höchste Effektstärke“, sagt er. „Ich glaube daran, dass wir alle ein Gefühl dafür haben, was uns guttut. Darauf sollten wir vertrauen.“ Er selbst setzt beispielsweise auf Eminems „Lose yourself“ mit circa 175 bpm, wenn er sich auf kritische sportliche Situationen vorbereiten möchte. Bei Muse mit „The 2nd Law: Unsustainable“ muss er hingegen aufpassen. „Ich weiß, dass mir das meistens zu stark ist. Danach bin ich direkt platt.“
Schnelle Beats können unsere Risikobereitschaft steigern
Die eigene Lieblingsmusik hat dabei noch einen, nicht immer sinnvollen, Effekt, sagt Jochen Steffens. „Unsere Risikobereitschaft steigt. Wir trauen uns mehr zu, sind dabei in manchen Fällen aber auch unvernünftig.“ Diesen Effekt gäbe es auch beim Musikhören während des Autofahrens. „Lassen wir unsere eigens gewählten Lieder laufen, werden wir im Straßenverkehr leichtfertiger; zumindest dann, wenn es sich um schnelle Tempi handelt. Das lässt sich auch auf den Sport übertragen. Deshalb sollten wir auch beim Training zum Lieblingssong achtsam bleiben.“
Selbst Musikmachen verbessert die sportliche Leistung
Aber nicht nur auf die richtige Musikauswahl kommt es an, sagt Professor Tom Fritz aus Leipzig. Er hat mit seinem Team am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften eine spannende Entdeckung gemacht: Wenn wir trainieren und dabei Musik nicht nur hören, sondern sie selbst entstehen lassen, hat das einen enormen Effekt auf unsere Stimmung – und damit auf unsere Leistung. Um zu dieser Erkenntnis zu kommen, hat Tom Fritz Fitnessgeräte so umgebaut, dass sie wie ein Musikinstrument funktionieren. Werden die Geräte benutzt, erzeugen sie einen Sound. „Unsere Studie hat gezeigt, dass Menschen Musik ganz anders und intensiver erleben, wenn sie sie selbst erzeugen“, sagt Tom Fritz. „Endorphine werden dabei besonders effektiv freigesetzt, und wir sind in der Lage, mehr Leistung zu bringen. Dabei wird dieselbe Leistung als weniger anstrengend empfunden und unsere Muskulatur wird entspannter und damit effizienter“. Vergleichbar sei der Trainingseffekt mit dem bekannten „Runners High“, den viele Läuferinnen und Läufer gut kennen. „Jymmin“ haben die Leipziger Wissenschaftler ihr Trainingskonzept genannt. Es wird bereits im Gesundheitssport erprobt. Wie es für den Extrakick beim Lauftraining helfen kann, ist noch nicht klar. Bis es soweit ist, greifen wir einfach weiter zu unseren Kopfhörern, vertrauen auf den Beat und unser eigenes Gefühl.